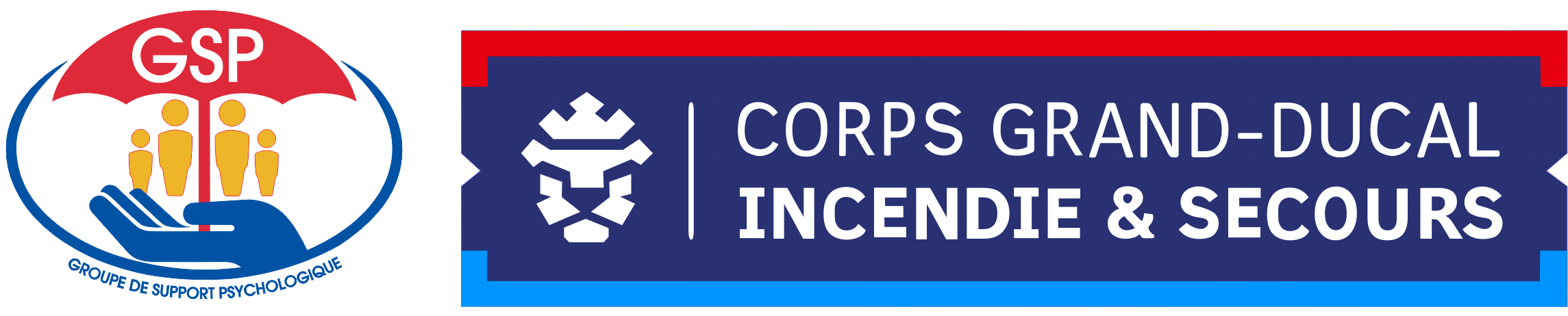LEBEN MIT DEM TOD Artikel an der Lëtzebuerger Revue
LEBEN MIT DEM TOD
Seit 1997 leistet der „Groupe de Support Psychologique“ Menschen in Schocksituationen Beistand. In Momenten, die das Leben von den Betroffenen ändern. Doch auch das der Helfer, wie das von Jakkie Paulus und Isabelle Decker – wenn auch auf eine ganz andere Weise.
Fotos: Anne Lommel
Es ist ein intimer Augenblick, in dem alles still und laut zugleich ist, und mit einem Atemzug nichts mehr ist, wie es war. Wenn alles steht und fällt und sich um sich selbst dreht, sind sie da. Jakkie Paulus und Isabelle Decker. Oder jemand anderes der insgesamt 67 Mitglieder (Stand 2017) des GSP. Die ehrenamtliche Organisation bietet eine erste Stütze, nachdem die Polizei überbringt, was kaum jemand hören will: unerwartete Todesnachrichten.
Die Mitglieder des GSP sind keine Psychologen. Sie zählen zu einer Spezialeinheit der „Protection Civile“, die dem Innenministerium anhängig ist. Nach einer zweijährigen Schulung haben die Helfer eine Ausbildung in der Krisenintervention. Ein Begriff, der den menschlichen Part ihrer Arbeit verschluckt. „Du gibst alles von dir. Physisch und psychisch. Du musst mitfühlen, ohne zu leiden“, beschreibt Isabelle. Sie lacht, lacht viel und gern. Das verraten auch die feinen Lachfältchen um ihre Augenwinkel. Nicht, weil sie das Thema nicht ernst nimmt, sondern, weil sie ihr Engagement als positive Arbeit versteht.
Jakkie Paulus und Isabelle Decker
Sie ist seit 2007 beim GSP, wechselte für den Freiwilligendienst sogar ihren Job. „Ich war 17 Jahre lang Journalistin. Ich habe mich nach meinem Erste-Hilfe-Kurs für den GSP entschieden, weil ich mein Wohlbefinden mit Menschen teilen wollte, die dieses Glück nicht haben“, verdeutlicht sie ihre Motivation. „Während der Ausbildung fühlte ich mich unwohl: Wie sollte ich auf der einen Seite den Familien und Betroffenen Schutz vor neugieriger Presse versprechen und andererseits in ebendiesem Bereich berufstätig sein? Ich geriet in einen Interessenkonflikt“, gesteht sie. Isabelle entschied sich für einen Job in einer Firma. Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Abgestumpft ist sie nach den vielen Jahren beim GSP nicht. Dafür ist ihre Leidenschaft zu groß, wenn sie über ihr Ehrenamt spricht. Ihre Worte zu gefühlvoll, wenn sie ihre Zeit beim GSP Revue passieren lässt.
Jeder Einsatz ist anders. Jede Erfahrung eine neue Herausforderung. Jeder Todesfall jedem Leben eigen. Obschon der Tod zum Leben gehört wie die Geburt, ist er vielen fremd. Eine verstörende, vergessene Gewissheit. „Für die meisten sind Trauer und Tod ein Tabu. Und jeder reagiert anders auf diesen Moment“, so die Sozialarbeiterin Jakkie. Einige Angehörige reagieren mit übersteigertem Aktionismus, Redefluss oder sogar Aggressivität. Auch das Gegenteil tritt auf: Sprachlosigkeit und körperliche Verkrampfung. Andere Betroffene sind völlig ungläubig und können das Geschehen nicht begreifen. Sie wollen den Tod nicht wahrhaben und leugnen ihn. Viele machen sich auch Vorwürfe, fragen sich, ob sie das Geschehene hätten verhindern können. Menschliche Reaktionen, die die Vielseitigkeit des Seins spiegeln. Hinzu kommen die Rituale der einzelnen Kulturkreise.
Nach einer zweijährigen Schulung haben die Helfer eine Ausbildung in der Krisenintervention. Ein Begriff, der den menschlichen Part ihrer Arbeit verschluckt.
Der GSP trifft auf Sprachbarrieren und unterschiedliche Glaubenstraditionen. Und das zu einem erdenklich schlechten Zeitpunkt. Doch auch das gehört zu ihrem Engagement. „Zu manchen Trauerritualen gehört das laute schreien, andere verlangen die Aufbahrung der Verstorbenen. Genauso gibt es Religionen, die es verbieten diese einzuäschern“, erklärt Jakkie Paulus. Alle Mitglieder des GSP werden im Umgang mit religiösen Bräuchen geschult.
Sprachliche Barrieren lassen sich nicht so einfach überwinden. Die ehrenamtlichen Helfer werden ähnlich unvermittelt mit den Geschehnissen konfrontiert, wie die Betroffenen. Selbst, wenn sie drei, vier Sprachen beherrschen, kommt es immer wieder vor, dass sie per Pieper zu einem Einsatz gerufen werden, bei dem ihre Kenntnisse unzureichend sind. „Mitten in der Nacht ist es schwer einen Übersetzter aufzutreiben, der beispielsweise arabisch spricht“, gesteht Isabelle. Jakkie fügt dem schnell hinzu: „Und selbst wenn du ihre Sprache sprichst, musst du dich darin wohlfühlen und auch Fachausdrücke kennen. Du sollst in dem Moment Sicherheit vermitteln und nicht nach Worten suchen.“
Die 27-Jährige fährt erst seit Juli 2017 beim GSP mit. „Ich habe mich schon früh für die Arbeit des GSP interessiert, doch das Mindestalter für die Zulassung zur Ausbildung liegt bei 21 Jahren.“ Jakkie lächelt. „Anfang 2015 war es für mich dann so weit.“ An ihren ersten Einsatz erinnert sie sich noch gut.
Sie stand damals nicht auf dem Dienstplan. Der Anruf kam spontan. Ob sie fit sei, hieß es am anderen Ende der Leitung. Es folgten wenige, kurze Infos zum Geschehen. Nichts Ausführliches, nur Eckdaten. Mit ihrem Privatauto – denn die Mitglieder des GSP fahren meist ohne Blaulicht und mit ihrem eigenem Wagen zum Einsatzort – machte sie sich auf den Weg. Die Theorie saß. Die Realität sah trotzdem anders aus. „Klar, du bist vorbereitet und weißt, was du zu tun hast. Aber aufregend ist es trotzdem, weil du nie weißt, was dich erwartet“, schildert sie.
Schon gewusst?
- 2016 rückte der GSP durchschnittlich fünf bis sechs Mal wöchentlich aus. Die Statistiken zu 2017 sind noch in Arbeit.
• Der GSP kommt auch nach Gewaltdelikten und in Krisensituationen zum Einsatz.
• Die Mitglieder, aus allen sozialen Schichten stammend, besuchen sowohl Privatpersonen als auch Firmen und Schulen, um sie in Schockmomenten zu begleiten. Auch Rettungskräfte können auf sie zurückgreifen.
• Der GSP übertragt selbst keine Todesnachrichten. Das fällt in den Aufgaben-
bereich der Polizei, da die Helfer nicht negativ behaftet sein dürfen.
• Sie arbeiten zudem eng mit Bestattungsunternehmen zusammen und begleiten die Hinterbliebenen zum Abschied nehmen oder zur Identifikation der Verstorbenen.
• Die ehrenamtlichen Mitglieder werden von der Rettungszentrale (112) via Pieper über Einsätze informiert. Dort werden die Anrufe von Notärzten des SAMU, der Polizei, der Rettungskräfte und der Feuerwehr zentralisiert. Doch können auch Privatpersonen und die Rettungszentrale selbst sie kontaktieren.
• Die Mitglieder sind verpflichtet, drei Mal jährlich eine Supervision durchzu-
führen sowie alle vier Jahre den Arbeitsarzt zu besuchen. Es ist wichtig, dass sie psychisch und physisch fit sind.
• Sie entscheiden freiwillig, ob sie einen Einsatz durchführen oder an einen anderen Helfer weitergeben wollen, beispielsweise, wenn sie die Verstorbenen oder die Hinterbliebenen persönlich kennen.
• Zwingende Voraussetzung zur Ausbildungszulassung ist der Nachweis über einen bestandenen Erste-Hilfe-Kurs.
Isabelle ist nicht mehr aufgeregt. Sie ist ein alter Hase und beobachtet einen sozialen Wandel: „Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Wir tendieren dazu, den Kontakt zu unseren Mitmenschen zu meiden, uns zu verschließen. In einer Schocksituation den Nachbarn anzurufen, ist heute keine instinktive Handlung mehr. Wir nehmen uns viel seltener Zeit miteinander zu reden oder einander zuzuhören.“
„Du sollst in dem Moment Sicherheit vermitteln und nicht nach Worten suchen.“ Jakkie Paulus
Eine Rolle, die der GSP in entsprechenden Momenten übernimmt. Gelassen, ruhig, sitzen Jakkie und Isabelle zusammen an einem Tisch. Sie sind ein eingespieltes Team, werfen sich vielsagende Blicke zu, wenn sie nach passenden Antworten auf komplexe Fragen suchen. Sie haben Zeit. Zeit, die sie Fremden nebenberuflich in Notsituationen schenken. Manche Einsätze dauern drei, andere sieben Stunden. Der GSP lässt niemanden allein, der nicht handlungsfähig ist. Bevor die Mitglieder gehen, helfen sie den Betroffenen ihr soziales Netzwerk zu aktivieren und geben Informationen und Flyer über spezifische Hilfsorganisation weiter. Für alle Fälle.
Spätestens mit 64 treten sie von ihrem Dienst zurück. So will es eine interne Reglung. Mit leeren Taschen, dafür mit vollen Herzen. Für Isabelle und Jakkie ist es nicht Geld, das bereichert. Es sind die dankenden Worte, die Menschen ihnen zurückgeben. Die Konfrontation mit schweren Schicksalsschlägen erinnert die beiden daran, dass es Schlimmeres gibt. Viel Schlimmeres, als Alltags-Bagatellen. Ihre Welt dreht sich weiter, trotz zerbeultem Auto oder umgekipptem Kaffee.
Belastende Mission
Zusammen mit seinem Team bereitet der Psychologe Marc Stein Polizeibeamten auf das Überbringen von Todesnachrichten vor. Eine Aufgabe, die die Medien im weiteren Sinn zusätzlich erschweren.
Marc Stein
Der 48-Jährige Marc Stein studierte Psychologie an der „Université libre de Bruxelles“ und ist seit 1997 als Leiter des „Service Psychologique“ der Police Grand-Ducale tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der angewandten kriminologischen, klinischen, Arbeits- und Krisenpsychologie. 2005 trat
er dem „Standing Committee Disaster, Crisis and Trauma Psychology“ der „European Federation for Psychologists’ Associations“ bei.
Die Hinterbliebenen von Unfalltoten oder unerwarteter Todesfälle sind nicht auf ihren Verlust gefasst. Die Polizisten, die die Nachricht überbringen, sind ihnen einen Schritt voraus. Wie bereiteten Sie die Beamten auf diese Aufgabe vor, Herr Stein?
Wir bilden unsere Beamten in vereinzelten Schulungen gezielt aus. Zusammen mit Schauspielern und Schauspielerinnen stellen wir Fallbeispiele nach und evaluieren im Anschluss, was gut lief und was verbesserungsfähig ist. Die Schüler nehmen die Übungen ernst: Den meisten gelingt es ,sich richtig in die Situation hineinzuversetzen.
Auf welche Reaktionen müssen sie sich einstellen?
Jedes Verhalten ist denkbar: Wut, die Infragestellung der Todesnachricht, Aggressivität, Zusammenbrüche, aber auch vollkommene Gleichgültigkeit. Die Beamten müssen sich vor dem Einsatz mental auf alles vorbereiten. Vor allem aber müssen sie verinnerlichen, dass es jede Reaktion zu respektieren gilt und sie nur dann eingreifen sollen, wenn die Betroffenen zur Gefahr werden. Oft schweigen die Hinterbliebenen erstmal. Lange. Den Raum und die Zeit muss man ihnen geben.
Die zuständige Abteilung der Polizei nennt sich „Service Psychologique de la Police Grand-Ducale“. Doch unterscheidet sich die Arbeit der Polizisten deutlich von dem eines klinischen Psychologen. Sie leisten quasi Erste-Hilfe für die Psyche.
Eine psychotherapeutische Behandlung will mittel- und langfristige Lösungen schaffen. Die Hilfeleistung durch den „Groupe de Support Psychologique“ und durch unsere Beamten vor Ort ist eine reine Akutmaßnahme. Es geht um psychosoziale Erste-Hilfe, keinesfalls um eine klinische Beratung oder psychotherapeutische Behandlung. Die Schulungen der Beamten durch den „Service Psychologique“ und das Angebot klinischer und psychotherapeutischer Nachbetreuung nach schweren Missionen, das fällt in den klassischen Arbeitsbereich der klinischen Psychologie.
Ist diese nach jeder überbrachten Todesnachricht und jeder Katastrophe nötig? Auf Seiten der Beamten und der Hinterbliebenen?
Die unerwartete Konfrontation mit dem Tod kann die Psyche verwunden. Aber die Wahl der Behandlung hängt mit der Tiefe und der Intensität der psychischen Verletzung, dem individuellen Erleben des Betroffenen und seiner momentanen psychischen Verfassung zusammen. Nicht jeder Kratzer oder jede Schürfwunde muss operativ behandelt werden. Klar, manche sind tief oder lassen alte Wunden wieder aufplatzen, sodass sie genäht werden müssen. Andere heilen jedoch auch ohne Behandlung mit der Zeit gut ab.
Konkret bedeutet das?
Wir neigen heutzutage dazu, zu sehr zu psychiatrieren und zu psychologisieren. Was potentiell ein Trauma sein könnte, wird gleich behandelt. Dabei kommen viele Hinterbliebene und eingesetzte Beamte eigenständig wieder auf die Beine, denn die Psyche ist fähig auch schlimme Erlebnisse zu verarbeiten. Ohne Psychotherapie oder psychiatrische Betreuung. Natürlich ist es wichtig auf mögliche Therapien zu verweisen und die Problemfälle ernst zu nehmen, doch eine Schocksituation ist nicht gleich ein Trauma. Nicht nach jedem Niesen muss ein Grippemedikament verschrieben werden. Manchmal ist es ratsam sowas auszukurieren, die Leiden zuzulassen, um selbstständig und stärker als je zuvor aus der Situation hervorzutreten.
Das trifft aber nicht auf alle zu.
Für die anderen ist es wichtig zu betonen, dass es Hilfsangebote wie den GSP, Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten gibt und es keine Schande ist, externe Hilfe zu beanspruchen. Manchmal entwickelt sich das Bedürfnis nach einer Therapie erst Jahre nach dem Einsatz oder dem einschneidenden Moment. Wir alle tragen einen Rucksack, gefüllt mit Steinen. Manchmal nehmen wir welche raus, manchmal kommen welche dazu. Der Rucksack belastet uns im Alltäglichen nicht zu stark. Manchmal jedoch wird der Rucksack so schwer, dass wir nach hinten umkippen. Spätestens dann ist es höchste Zeit reinzuschauen, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen und Ballast abzuwerfen.
Allerdings zwingt einen die mediale Berichterstattung manchmal regelrecht dazu, seine Steine vor Anderen auszubreiten.
Über Katastrophen, Unfälle und unerwartete Todesfälle zu berichten ist eine heikle Angelegenheit – und dessen sind sich Medienhäuser oft nicht bewusst. Außerdem dringen oft Informationen in die Öffentlichkeit, noch bevor unsere Beamten reagieren können. Das sind meist unzulängliche Infos, die mögliche Hinterbliebene nur unnötig belasten. Die Beamten werden von ihnen dann mit Informationen konfrontiert, über die sie selbst keine Gewissheit haben.
Was legen Sie Medienvertretern und Vertreterinnen ans Herz?
Zuerst sollte sich jedes Medium die Frage stellen: Wie müssen wir über dieses Ereignis berichten? Ist es notwendig die Opfer öffentlich darzustellen? Letzteres sollte vor allem bei Suizidfällen verneint werden. Hier ist das Risiko hoch, dass sich Menschen in ähnlich schwierigen Lebenssituationen mit dem Suizidanten identifizieren: der berühmte Nachahmeffekt.
Also lieber nur noch Friede, Freude, Eierkuchen in der Medienlandschaft?
Nein, die Menschen haben das Recht von Geschehnissen zu erfahren, das steht außer Frage. Nur sollten Terroranschläge, Flugzeugabstürze, Verkehrsunfälle, Suizide – und ähnliche Ereignisse – nicht dauertrommelfeuerartig breit getreten werden.
Was wäre sinnvoller?
Ein Liveticker über jeden geborgenen Toten oder Bilderfluten von bis zur Unkenntlichkeit zerstörten Autos hat keinen Mehrwert. Ebenso wenig ein Beitrag, der die Hinterbliebenen oder die Einsatzkräfte direkt nach dem Geschehen vor die Kamera zerrt. In solchen Momenten ist der Betroffene weder kognitiv noch emotional auf der Höhe. Man sagt und tut Dinge, die man später vielleicht bereut – dann kursieren die eigene Stimme und das Gesicht aber schon im öffentlichen Raum, im Internet leider sogar fast auf ewig. Fairer wäre es diese Menschen Wochen nach der Katastrophe um ein Interview oder ähnliches zu bitten, wenn der erste Schock verdaut ist.
Medien haben einen großen Impakt auf die Gesellschaft. Wie können sie diesen in solchen Fällen positiv einsetzen?
Indem sie über Beratungsstellen informieren, indem sie den Konsumenten Tipps zum Aufbau eigener Kräfte und Ressourcen geben anstatt 24 Stunden, täglich, nur Negativmeldungen zu vermitteln. Zwischendurch muss Luft zum Atmen bleiben, sonst entwickeln immer mehr Menschen tiefgreifende Ängste und verschließen sich einer Welt, die bei allem schlechten auch sehr viel Positives zu bieten hat.